|
BERICHTE
|
|
Weihnachtsfeier des Kirchenchores am 4. Dezember 2025
Am 4. Deze mber 2025 war es wieder einmal so weit. Der Chor feierte seine diesjährige Weihnacht an der von unseren Sängerinnen festlich geschmückten Tafel im Stieldorfer Gemeindehaus. Alle hatten sich mit Köstlichkei mber 2025 war es wieder einmal so weit. Der Chor feierte seine diesjährige Weihnacht an der von unseren Sängerinnen festlich geschmückten Tafel im Stieldorfer Gemeindehaus. Alle hatten sich mit Köstlichkei ten zum gemeinsamen Schmaus beteiligt. Auch unser Chorleiter Friedhelm Loesti trug mit selbst Gebackenen zum Wohlfinden bei. Als Dank für sein musikalisches Bemühen im zu Ende gehenden Jahr erhielt er einen kleinen Präsentkorb, zu dessen Inhalt auch unsere Sängerin Gabi Schmidt – sie hatte in den vergangenen Tagen großes persönliches Leid erfahren müssen - mit Freude beitrug. ten zum gemeinsamen Schmaus beteiligt. Auch unser Chorleiter Friedhelm Loesti trug mit selbst Gebackenen zum Wohlfinden bei. Als Dank für sein musikalisches Bemühen im zu Ende gehenden Jahr erhielt er einen kleinen Präsentkorb, zu dessen Inhalt auch unsere Sängerin Gabi Schmidt – sie hatte in den vergangenen Tagen großes persönliches Leid erfahren müssen - mit Freude beitrug.
Schnell vergingen die Stunden: Sie waren geprägt von inhaltsreichen, aber auch amüsanten Unterhaltungen
Leider fehlte ein kleines Dankeschön unserer Pastorin für das Engagement des Stieldorfer/Birlinghovener Kirchenchores bei der musikalischen Gestaltung zahlreicher Gottesdienste.
Der nächste Chorauftritt steht für den 21. Dezember mit der Aufführung der Weihnachtsgeschichte des Schlesiers Max Drischner an. Sie entstand in den letzten Kriegstagen des Jahres 1944, bevor die Flucht der Ostdeutschen aus ihrer angestammten Heimat in den Westen begann.
|
|
|
|
|
|
Chorausflug 2025
Am 31. Juli besuchte unser Stieldorfer-Birlinghovener Kirchenchor den Propsteigarten von St. Pankratius in Oberpleis. Wir erlebten dort eine spannende und überaus interessante, kenntnisreiche Führung mit Frau Evelyn Steppacher. Den meisten von uns war der Probsteigarten unbekannt, und so wurde die Führung zu einem eindrucksvollen Erlebnis. In knapp einer Stunde erfuhren wir Details aus der Historie des Gartens, zugleich wurden wir in seine vielfältige Flora mit Rosen, Nutzpflanzen wie Kräuter, Gemüse und Obstbäumen eingeweiht. Das Wetter spielte mit und verschonte uns mit angekündigten Regengüssen.
Erst beim Eintreffen in der gemütlichen Gaststätte Alter Zoll zum Ausklang des anregenden Chorevents wurde es naß, doch da befanden wir uns bereits bei Speis und Trank im Trockenen.
Den Organisatoren des gelungenen Propsteigartenbesuchs sei für ihre Mühen herzlich gedankt.
|
|
 Chorweihnachtsfeier am 12. Dezember 2024 Chorweihnachtsfeier am 12. Dezember 2024
In fröhlicher Runde fand die Weihnachtsfeier unseres kleinen Kirchenchores in Stieldorf statt.
Gute Gespräche begleiteten die Feier. Jeder hatte zum Knabbern etwas mitgebracht; daneben gab es Glühwein und Punsch ohne Alkohol – also etwas für jeden nach seinem Geschmack.
Es wurden Weihnachtslieder gesungen, begleitet von unserem Chorleiter Loesti. Er verlas zur Freude aller eine aus dem Mongolischen stammende Weihnachtsgeschichte, die von einem Tannenbaum handelte, den die Akteure nicht finden konnten, schließlich aber doch auf rätselhafte Weise entdeckten, um so Weihnachten genießen zu können. Abgerundet wurde das Ganze mit einem Märchenquizz.
Großes Bedauern löste die Ankündigung unserer langjährigen Sängerin Bernadette Olbrecht aus, den Chor aus familiären Gründen nicht mehr regelmäßig zu unterstützen. Sie wird ihn aber nicht gänzlich aus den Augen verlieren.
|
|
Max Drischner
Die Weihnachtsgeschichte 2023
2018 führte unser Chor erstmals die Komposition Die Weihnachtsgeschichte des Schlesiers Max Drischner auf. Auch in der Weihnachtszeit 2023 wollen wir als Chor diese eindrucksvolle Weihnachtsgeschichte den Kirchenbesuchern – diesmal am 17. Dezember – in der beeindruckenden evangelischen Holzkirche in Oberpleis wieder zu Gehör bringen. Als Evangelist erfreute Claudia Rapp-Neumann mit ihrem klaren Sopran und Dagmar Ziegler mit ihrer Querflöte die Zuhörer. Souverän begleitete Dr. Friedhelm Loesti an der Orgel.
Am 1. Weihnachtstag, Montag, dem 25. Dezember, um 10.30 Uhr, wird die Weihnachtsgeschichte abermals, und zwar in der evangelischen Kirche in Stildorf zu hören sein. Lassen Sie sich diese musikalische Freude nicht entgehen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Weihnachtsfeier des Chores 2023
mit viel Fröhlichkeit, Frohsinn und allerlei Leckereien.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chorausflug am 15. Juni 2023 nach Bad Münstereifel
Bei strahlendem Sonnenschein brach unsere kleine Chorfamilie um 13.30 Uhr in Stieldorf zu ihrem diesjährigen Ausflug  nach Bad Münstereifel auf. Treffpunkt war der Parkplatz vor der romanischen Basilika St. Chrysanthus et Daria. Leider konnten nicht alle Chormitglieder dabeisein und an der Stadtführung, die G. Arnold ab 15.00 Uhr humorvoll, außerordentlich kenntnisreich und damit sehr interessant gestaltete, teilnehmen. nach Bad Münstereifel auf. Treffpunkt war der Parkplatz vor der romanischen Basilika St. Chrysanthus et Daria. Leider konnten nicht alle Chormitglieder dabeisein und an der Stadtführung, die G. Arnold ab 15.00 Uhr humorvoll, außerordentlich kenntnisreich und damit sehr interessant gestaltete, teilnehmen.
Das Benediktinerkloster (lat. monasterium), dem Münstereifel Entstehung und Namen verdankt, wurde im Jahr 830 von dem Prümer Abt Marquard - mit den Karolingern eng verbunden - gegründet. Über Marquard gelangten im Jahr 844 die Reliq uien des römischen Märtyrerpaars Chrysanthus und Daria nach Münstereifel und verschafften dem neuen Kloster einen beträchtlichen Bedeutungszuwachs. Die heutige Basilika wurde im 11. Jahrhundert erbaut, leider war eine Besichtigung dieser romanischen Kirche wegen der immer noch nicht völligen Beseitigung der Hochwasserschäden von 2021 unmöglich. Das zeigte sich auch an zahlreichen Gassen in der Innenstadt, auch hier waren die vielen Wasserschäden noch sichtbar. uien des römischen Märtyrerpaars Chrysanthus und Daria nach Münstereifel und verschafften dem neuen Kloster einen beträchtlichen Bedeutungszuwachs. Die heutige Basilika wurde im 11. Jahrhundert erbaut, leider war eine Besichtigung dieser romanischen Kirche wegen der immer noch nicht völligen Beseitigung der Hochwasserschäden von 2021 unmöglich. Das zeigte sich auch an zahlreichen Gassen in der Innenstadt, auch hier waren die vielen Wasserschäden noch sichtbar.
Bei dem rund einstündigen Rundgang durch Bad Münstereifel wurde die ganze Schönheit des Eifelstädtchens offenbar. Eingerahmt von einer unzerstörten mittelalterlichen Stadtmauer mit vier erhaltenen Stadttoren sowie der mitten durch den Ort strömenden Erft erlebten wir eine Idylle. Die Erft fl oß so friedlich daher, niem oß so friedlich daher, niem and konnte sich auch nur annähernd die Flutkatastrophe von 2021 vorstellen. and konnte sich auch nur annähernd die Flutkatastrophe von 2021 vorstellen.
Frau Arnold berichtete u. a. von ihren Recherchen zu einer historischen Darstellung des pädagogischen Wirkens von Schwester Ursula Scheeben für die Frauenbildung. Ihr Wirken ging von ihrem Eintritt in das Münstereifeler Salvatorkloster anno 1842 aus. Die Flutkatastrophe beendete das Vorhaben unserer Stadtführerin, weil die zur Auswertung bereitstehenden Akten des städtischen Archivs von den Wassermassen unwiederbringlich zerstört worden waren.
Die Geschichtsmächtigkeit Münstereifels erlebten wir nicht nur an der allgegenwärtigen Stadtmauer. Sie offenbarte sich auch an zahlreichen historischen Gebäuden – etwa dem einstigen Jesuitenkolleg, heute das Domizil des Michaelsgymnasiums. Ein anderes historisches Kleinod ist das Rathaus mit seinem imposan ten Pranger. Auch einem leibhaftigen König, und zwar König Sventibold von Lothringen (*870/871 - †900; König zwischen 895 – 900) durften wir begegnen; Sventibold war der illegitime Sohn des deutschen Königs und römischen Kaisers Arnulf von Kärnten (* um 850 - †899), er ziert heute einen herrlichen Brunnen im Marktbereich Münstereifels. ten Pranger. Auch einem leibhaftigen König, und zwar König Sventibold von Lothringen (*870/871 - †900; König zwischen 895 – 900) durften wir begegnen; Sventibold war der illegitime Sohn des deutschen Königs und römischen Kaisers Arnulf von Kärnten (* um 850 - †899), er ziert heute einen herrlichen Brunnen im Marktbereich Münstereifels.
Der Spmünstereifel3_150623aziergang durch die historische Altstadt ließ auch die dunklen Seiten unserer Geschichte sichtbar werden: In der Gasse An der Scho ßpforte erinnerten in das Straßenpflaster eingelegte Bronzesteine daran, daß hier einst lebende jüdische Mitbürger im Namen unseres Volkes von einer verbrecherischen Clique 1942 in Auschwitz und Theresienstadt getötet wurden. Die Mehrheit schwieg - wie immer, und wer sich trotz allem gegen diese Verbrechen erhob, wurde hingerichtet. Dieses Schicksal erlitt beispielhaft der Warendorfer Franziskanerpater Elpidius Josef Markötter. In einer Predigt, gehalten im Mai 1940, hatte er ausgeführt: Wir müssen alle Menschen lieben, auch die Juden und Polen, die in Nazi-Deutschland als “Untermenschen” der Willkür ausgeliefert waren. Pater Markötter starb in Dachau, noch nicht 31 Jahre alt, 1942. Hüten wir uns, die wir heute leben dürfen, davor, wieder von Minderheiten auf subtile Weise mißbraucht zu werden. Setzen wir uns als mutige Bürger zur Wehr! ßpforte erinnerten in das Straßenpflaster eingelegte Bronzesteine daran, daß hier einst lebende jüdische Mitbürger im Namen unseres Volkes von einer verbrecherischen Clique 1942 in Auschwitz und Theresienstadt getötet wurden. Die Mehrheit schwieg - wie immer, und wer sich trotz allem gegen diese Verbrechen erhob, wurde hingerichtet. Dieses Schicksal erlitt beispielhaft der Warendorfer Franziskanerpater Elpidius Josef Markötter. In einer Predigt, gehalten im Mai 1940, hatte er ausgeführt: Wir müssen alle Menschen lieben, auch die Juden und Polen, die in Nazi-Deutschland als “Untermenschen” der Willkür ausgeliefert waren. Pater Markötter starb in Dachau, noch nicht 31 Jahre alt, 1942. Hüten wir uns, die wir heute leben dürfen, davor, wieder von Minderheiten auf subtile Weise mißbraucht zu werden. Setzen wir uns als mutige Bürger zur Wehr!
Bevor wir die Heimreise antraten, fand der Chorausflug einen besinnlichen Abschluß im Café Marielle. Alle bedauerten, daß der erlebnisreiche Tag so schnell dem Ende entgegenging.
|
|
Machen Sie mit in unserem Chor
Wenn Sie gern singen, dann sind Sie bei uns richtig. Das Alter spielt keine Rolle, nur Lust am Singen sollten Sie haben!
Zu unseren Choraktivitäten:
Zu unserem Repertoire gehört sowohl die geistliche als auch die weltliche Musik. Auch die Geselligkeit verbunden mit interessanten Tagestouren pflegen wir.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, kommen Sie zum Schnuppern zu unseren Chorproben im Gemeindehaus Stieldorf, Oelinghovener Str. 38 a, 53639 Königswinter, jeweils donnerstags von 19.45 bis 21.25 Uhr.
|
|
|
|
|
|
Weihnachtsfeier des Kirchenchores 2022
Die Chorprobe am 15. Dezember, in der Andreas Hammerschmidts vierstimmiger Satz Ihr lieben Hirten, fürchtet euch nic ht im Mittelpunkt stand – dieses Mal mit Flöten- und natürlich Orgelbegleitung -, verdeutlichte jedem, wie prekär unsere Lage als Chor ist. Rüdiger Haffner fiel wegen eines Unfalls aus, somit blieb unsere einzige Tenorstimme unbesetzt. Eine fatale Situation bei einem vierstimmigen Satz! ht im Mittelpunkt stand – dieses Mal mit Flöten- und natürlich Orgelbegleitung -, verdeutlichte jedem, wie prekär unsere Lage als Chor ist. Rüdiger Haffner fiel wegen eines Unfalls aus, somit blieb unsere einzige Tenorstimme unbesetzt. Eine fatale Situation bei einem vierstimmigen Satz!
Deshalb wiederholt der Chor seine vielfach geäußerten Anregungen und Bitten an Sänger und Sängerinnen, die nach sängerischem Mitwirken suchen:
Kommen Sie zu uns – gleich, welchen Alters – und machen Sie mit! Sie werden Freude in einer aufgeschlossenen, freundlichen Gemeinschaft haben.
Für die nach der Probe startende vorweihnachtliche Feier hatten die Sängerinnen alles aufs Feinste vorbereitet: Eine festlich geschmückte Tafel, und überhäuft mit vielerlei Köstlichkeiten machte die Feier zu einem wahrhaften Erlebnis. Allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben, sei an dieser Stelle für ihre Mühen auf das Herzlichste gedankt. Das gezeigte ehrenamtlichen Engagement war und ist bewundernswert! Nochmals: von Herzen Dank!
|
|
Festgottesdienst am 1. Januar 2022 anläßlich der Fusion zur
Evangelischen Kirchengemeinde Siebengebirge
in der Auferstehungskirche Ittenbach
Mit einem Festgottesdienst in der Ittenbacher Auferstehungskirche am 1. Januar 2022 – so war es der örtlichen Presse zu e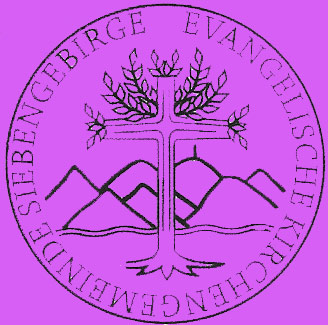 ntnehmen – fusionierten die bisher selbständigen evangelischen Kirchengemeinden Bad Honnef-Ägidienberg, Ittenbach, Oberpleis und Stieldorf-Birlinghoven zur Evangelischen Kirchengemeinde Siebengebirge, kurz Ekisi. Der feierliche Gründungsgottesdienst fand statt in Anwesenheit der Superintendentin des Kirchenkreises An Rhein und Sieg, Almut van Niekerk, und des Leitenden Pfarrers der katholischen Pfarreiengemeinschaft Königswinter – Am Ölberg, Markus Hoitz. In seinem Grußwort betonte er, daß er sich auf eine „fruchtbare ökumenische“ Zusammenarbeit freue. Auch die evangelische Kirchengemeinde Heisterbacherrott- Thomasberg – sie hätte der Großgemeinde Siebengebirge angehören sollen, war präsent. Die Vertreterin der Emmausgemeinde überbrachte Saatgut und Blumenerde und verband dies mit dem Wunsch, die neue Gemeinde möge blühen, „buntes Leben“ anziehen und „sich über ihre Grenzen“ weiterverbreiten. Musikalisch gestaltete der achtstimmige Chor der evangelischen Kirchengemeinde die Feierlichkeit. ntnehmen – fusionierten die bisher selbständigen evangelischen Kirchengemeinden Bad Honnef-Ägidienberg, Ittenbach, Oberpleis und Stieldorf-Birlinghoven zur Evangelischen Kirchengemeinde Siebengebirge, kurz Ekisi. Der feierliche Gründungsgottesdienst fand statt in Anwesenheit der Superintendentin des Kirchenkreises An Rhein und Sieg, Almut van Niekerk, und des Leitenden Pfarrers der katholischen Pfarreiengemeinschaft Königswinter – Am Ölberg, Markus Hoitz. In seinem Grußwort betonte er, daß er sich auf eine „fruchtbare ökumenische“ Zusammenarbeit freue. Auch die evangelische Kirchengemeinde Heisterbacherrott- Thomasberg – sie hätte der Großgemeinde Siebengebirge angehören sollen, war präsent. Die Vertreterin der Emmausgemeinde überbrachte Saatgut und Blumenerde und verband dies mit dem Wunsch, die neue Gemeinde möge blühen, „buntes Leben“ anziehen und „sich über ihre Grenzen“ weiterverbreiten. Musikalisch gestaltete der achtstimmige Chor der evangelischen Kirchengemeinde die Feierlichkeit.
|
|
Zusammenschluß der fünf evangelischen Siebengebirgsgemeinden
Seit 2019, so berichtete es die lokale Presse, aber so konnte man es zuletzt im Spektrum (3/2021), dem Gemeindeblatt der Pfarrbezirke I und II (Stieldorf/Birlinghoven und Heisterbacherrott/Thomasberg) lesen, verhandelten die fünf evangelischen Kirchengemeinden Stieldorf/Birlinghoven, Heisterbacherrott/Thomasberg, Ittenbach, Oberpleis und Bad Honnef/Aegidienberg über die Fusion zu einer Großgemeinde ab dem 1. Januar 2022. Man las aber auch im Spektrum, daß das Presbyterium der Emmausgemeinde in einem Beschluß vom 6. Juli 2021 diesen Fusionsschritt nicht weiter mitgehen, sondern eigenständig bleiben wolle. Über die Gründe für die Kehrtwendung erfuhr der geneigte Leser nichts, außer, daß die Mehrzahl der Gemeindemitglieder diesen Sonderweg unterstütze. Leider ist mir diese Diskussion eines Für und Wider der Fusion unter den Gemeindemitgliedern entgangen. War sie vielleicht nur einem esoterischen Kreis vorbehalten?
Ich begrüßte daher die Aufforderung im Editorial von Spektrum 3/2021, in dem es hieß: […] lesen Sie, was Gemeindemitglieder über den eingeschlagenen Weg denken. Teilen auch Sie uns Ihre – gegebenenfalls abweichende – Meinung mit, sodass wir darauf eingehen können. Ich formulierte daraufhin meine Gedanken als Plädoyer für den Zusammenschluß der fünf evangelischen Siebengebirgsgemeinden (siehe Text weiter unten)und stellte sie Spektrum zur Verfügung.
Es folgten mehrere ausführliche und zugleich abstimmende Gespräche sowohl mit Frau Pastor Haase-Schlie als auch mit Herrn Pastor Dr. Weitenhagen. Danach fertigte ich die endgültige Fassung des Textes. Überrascht war ich, daß während eines Klinikaufenthaltes Frau Pastor Haase- Schlie meiner Frau telefonisch mitteilte, mein Beitrag werde im Spektrum wegen Platzmangels nicht veröffentlicht! Soviel zur Diskussion abweichender Meinungen innerhalb der Führung der Gemeinde.
Meine Intervention bei der Superintendentur des Evangelischen Kirchenkreises an Rhein und Sieg führte zu einer neuerlichen längeren Unterredung mit Frau Pastor Haase-Schlie. Das Gespräch verlief harmonisch und sehr freundlich. Aber ich erfuhr nichts Neues, warum die Gemeinde Heisterbacherrott/Thomasberg den eingeschlagenen Weg der Eigenständigkeit weiter beschreitet, außer, daß die Gemeindevertreter bei den Verhandlungen mit den vier anderen Gemeinden jeweils überstimmt wurden. Die Hintergründe dieses Abstimmungsverhaltens wurden nicht offengelegt. Ein weiteres Ergebnis des Gesprächs: Mein Text wird nicht veröffentlich.
Ein Gespräch mit Frau Pastor Ute Krüger am 13.12. bestätigte die Problematik der Abstimmungen, aber sie nannte aus Loyalitätsgründen keine Einzelheiten. Sie hätte jedoch die Fusion der fünf Einzelgemeinden zu einer Großgemeinde begrüßt.
Für unseren Chor hätte der Sonderweg von Heisterbach/Thomasberg einschneidend sein können. Würden nämlich die fünf Heisterbacherrotter/Thomasberger Chorsänger den Sonderweg ihrer Gemeinde mitvollziehen, wäre das das Ende des Chores. Glücklicherweise wird es dazu nicht kommen; vielmehr freut sich der Chor auf die Zusammenarbeit mit den anderen Chören der sich. zum 1. Januar 2022 zusammenschließenden Gemeinden. Das könnte der Anfang sein, anspruchsvolle Werke einzustudieren und in den einzelnen Gemeinden zu Gehör zu bringen. Endlich wären dafür auch die personellen Ressourcen vorhanden.
Der Fusionsgedanke zu einer evangelischen Großgemeinde im Siebengebirge muß nicht aufgegeben werden. Unter anderem finanzielle Probleme bei unvermindert anhaltenden Kirchenaustritten, aber auch andere personelle Zusammensetzungen der Presbyterien lassen hoffen, daß es möglichst bald ein Umdenken auch in der Gemeinde Heisterbacherrott/Thomasberg einkehrt und die Fusionsgemeinde der evangelischen Kirchen des Siebengebirges, die auch der Kirchenkreis befürwortet, Realität wird.
|
|
Plädoyer für den Zusammenschluß der fünf evangelischen Siebengebirgsgemeinden
Das Forschungszentrum Generationenverträge (FZG) der Albert-Ludwig-Universität Freiburg geht in einer koordinierten Mitglieder- und Kirchensteuervorausberechnung für die katholische und evangelische Kirche in Deutschland davon aus, daß die EKD in den kommenden 40 Jahren etwa die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren wird. Das bedeutet, daß sich damit die finanzielle Leistungsfähigkeit der evangelischen Kirche im gleichen Zeitraum etwa halbieren wird. Das hat u. a. Auswirkungen auf die Zahl der aktiven Kirchenmitarbeiter. Sie wird erheblich sinken, gleiches gilt für die Zahl der z. T unter Denkmalschutz stehenden Kirchen. Eine Neuausrichtung der Kirche ist unausweichlich, und sie wird über neue Strukturen nachsinnen müssen. Gleichwohl muß sie die Menschen auch in Zukunft mit ihren Angeboten erreichen. Für die örtlichen Gemeinden bedeutet das, daß sie bereits heute die Kräfte bündeln müssen, um ihren kirchlichen Aufgaben gerecht zu werden.
Die evangelischen Gemeinden im Siebengebirge haben diese Notwendigkeit frühzeitig erkannt und verhandeln seit 2019 darüber, eine große Fusionsgemeinde zu bilden. Betroffen war der geneigte Leser, als er im Editorial von Spektrum 3/2021 und in Evangelisch im Siebengebirge 2/2021 las, die Emmaus-Gemeinde in Thomasberg-Heisterbacherrott werde zum 1. Januar 2022 einen Sonderweg gehen und eigenständig bleiben. Begründet wird dieser Schritt nicht. Die Emmaus-Gemeinde wird somit nicht der Fusionsgemeinde, zu der sich die bisher selbständigen Gemeinden Ittenbach, Oberpleis, Stieldorf-Birlinghoven und Bad Honnef-Ägidienberg zusammenschließen, angehören.
Warum wird dieser notwendige Fusionsschritt plötzlich nicht von allen Gemeinden mitgetragen, zumal aus Gesprächen mit Seelsorgern abzuleiten ist, sie hielten eine Fusion zu einer Großgemeinde für den Schritt in die richtige Richtung?
Was ist demnach letztlich in den Fusionsverhandlungen, die zum größten Teil in Unkenntnis der betroffenen Gemeindemitglieder geführt wurden, „schief“ gelaufen?
An der segensreichen Tätigkeit der verschiedenen ehrenamtlichen Gruppen in den einzelnen Gemeinden kann es nicht liegen, denn ihre Arbeit geht unabhängig von einer Fusion unberührt weiter. Welches sind demnach die entscheidenden Gründe, weshalb eine Gesamtfusion nicht umgesetzt wird? Lag es an mangelnder Kompromißbereitschaft einzelner oder vielleicht an den Presbytern, deren Mitgliederzahl bei einer Fusion – gerechnet auf die einzelnen Gemeinden – sich wesentlich verringern wird?
Es ist von erheblicher Bedeutung für die Zukunft der Gemeinden Ittenbach, Oberpleis, Stieldorf-Birlinghoven, Thomasberg-Heisterbacherrott und Bad Honnef-Ägidienberg, daß die Gemeindemitglieder die Fusion zu einer Großgemeinde auch in der jetzigen Vorbereitungsphase erörtern und die Entscheidung nicht allein den Presbytern überlassen.
|
|
Weihnachtsgottesdienst online in der evangelischen Auferstehungskirche Ittenbach
Am 15. Dezember 2021 spielte der Chor Weihnachtslieder ein für den Heiligabendgottesdienst in der Auferstehungskirche in Ittenbach, und zwar online. Es war ein gelungenes Einspiel! Der Gottesdienst ist zu verfolgen unter www.youtube.com/watch?v=VcaqLUt8DAE
|
|
Chorbegegnung in der Coronakrise
Am 1. Oktober traf sich der Chor ein zweites Mal in der Coronakrise im Gemeindehaus in Birlinghoven (Eine erste Begegnung hatte am 27. Juli - ebenfalls in Birlinghoven - stattgefunden). Wiederum hatte Ursula Blondiau die Begegnung liebevoll organisiert. Fast alle Sänger waren ihrer Einladung gefolgt; schnell fand man wieder im Gespräch zueinander. Zum Glück waren alle von einer Infektion verschont geblieben.
Leider gab es keinen Ausblick, wie es mit dem Chorsingen weitergehen wird. Ob es zu den Weihnachtsfestlichkeiten ein Auftreten des Chores geben wird, geschweige, wanns die ersten regulären Proben stattfinden werden, blieb ungeklärt. Auch ein Termin für ein weiteres informelles Treffen wurde nicht festgelegt. Zu hoffen bleibt, daß dies bald geschieht, damit alle Fragen, die den Chor und sein weiteres Agieren betreffen, eine Beantwortung finden.
|
|
|
|
|
|
Der Chor der evangelischen Kirche Stieldorf/Birlinghoven-Heisterbacherrott auf Spurensuche
Am 5. September trafen sich die Sänger zu ihrem alljährlichen Chorausflug. Das Ziel war diesmal der Bonner Stadtteil Vilich. Bereits das Eintreffen in die dörfliche Idylle wurde zu einem Erlebnis: wunderschöne Fachwerkhäuser, enge Gassen und alte Torbögen – Zeugnisse einer vergangenen Zeit. Frau Ursula Becker, die Schriftführerin des örtlichen Denkmal- und Geschichtsvereins Bonn-Rechtsrheinisch e. V., und die Stadtführerin Frau Schmitz-Wulf begrüßten ihre Gäste in Räumlichkeiten des Adelheid-Stifts; sie sollten in Stadtführerin Frau Schmitz-Wulf begrüßten ihre Gäste in Räumlichkeiten des Adelheid-Stifts; sie sollten in  den folgenden drei Stunden die sachkundigen Begleiterinnen in Vilich werden. den folgenden drei Stunden die sachkundigen Begleiterinnen in Vilich werden.
Den wenigsten wird bewußt gewesen sein, daß dieser Ort eine uralte geschichtliche Tradition besitzt. Entstanden rechtsrheinisch als Siedlungsplatz auf dem Territorium der germanischen Tenkterer in unmittelbarer Nachbarschaft der Römer in Colonia Agrippina (Köln) und des Römerlagers in Castra Bonnensis (Bonn), findet er die erste Erwähnung in einer Urkunde König Ottos d.Gr. im Jahre 942 als villicam. Bei archäologischen Grabungen fand man fränkische Gräber aus dem 5. nachchristlichen Jahrhundert. Im 9. Jahrhundert entstand vor Ort ein kleiner, fast quadratischer Kapellenbau, der im 10. Jahrhundert um das Doppelte vergrößert wurde. Zwischen 980 bis 1030 folgte der A usbau als einschiffige Stiftskirche St. Peter. Der Anlaß war die Gründung des Stifts Vilich 978. Zwischen 1040 bis 1280 entwickelte sich aus dem romanischen Kirchbau eine dreischiffige Basilika mit gotischem Chor. usbau als einschiffige Stiftskirche St. Peter. Der Anlaß war die Gründung des Stifts Vilich 978. Zwischen 1040 bis 1280 entwickelte sich aus dem romanischen Kirchbau eine dreischiffige Basilika mit gotischem Chor.
In einer Reihe von Kriegen, besonders dem Dreißigjährigen Krieg, wird St. Peter zerstört, teilweise wird die Ruine vergleichbar mit der Benediktinerabtei Heisterbach als „Steinbruch“ genutzt; ihre heutige Form findet die Kirche um 1700. Zur beachtenswerten Ausstattung des Kirchraums zählen das Grab der Hl. Adelheid, ein Taufstein aus dem 16.Jahrhundert, die Riegerorgel (1958) und die von W. Benner geschaffenen Glasfenster (1959, 1965/66).
Megingoz von Geldern und dessen Ehefrau Gerberga, Tochter des lothringischen Pfalzgrafen Gottfried, waren die Eltern der Hl. Adelheid. Megingoz entstammte dem niederen Adel, doch seine Gattin gehörte dem Hochadel an; sie war die Enkelin des westfränkischen Königs Karls III. (d. Einfältigen) und Nichte des Kölner Erzbischof Wichfrid (924-953). Insbesondere Gerberga konnte sich der Unterstützung der westfränkischen und der ottonischen Herrscher im von Heinrich I. (919-936) 919 errichteten deutschen Reich gewiß sein (in diesem Jahr begeht es sein 1100jähriges Jubiläum).
Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor: vier Töchter – darunter Adelheid - und der Sohn Gottfried. Als dieser auf einem Kriegszug Kaiser Ottos II. gegen die Böhmen 976 oder 977 fiel, gründeten die Eltern ihrem Sohn zum Gedächtnis 978 auf ihrem Grund und Boden bei Vilich ein Frauenstift. König Otto III. erhob dieses Stift 987 zum Reichsstift mit besonderen  Privilegien, wie sie auch die drei Stifte Privilegien, wie sie auch die drei Stifte  Quedlinburg, Gandersheim und Essen besaßen. Quedlinburg, Gandersheim und Essen besaßen.
Adelheid, geboren um 970 in Geldern, verstorben um 1015 in Köln, leitete das Stift Vilich als erste Äbtissin. Nach dem Tode ihrer Schwester Bertrada, Äbtissin des Kölner Klosters St. Maria im Kapitol, übernahm Adelheid nach ernstem Sträuben, zusätzlich dieses Amt. Erzbischof Herbert (999-1021) mußte Kaiser Otto II. einschalten, um Adelheid von ihrer Weigerung abzubringen. Da Adelheid die Klosterschule in Vilich gründete, besuchte sie der Überlieferung gemäß so oft es ihr möglich war den Unterricht und überzeugte sich vom Wissen der Schülerinnen. Die in lateinischer Reimprosa 1057 verfaßte Vita Sanctae Adelheydis Virginis ist ein Beleg für die frühe Blüte der Klosterschule.
Adelheid war nach der Überlieferung eine Wohltäterin der Armen. Sie versorgte sie bei Dürrezeiten mit Speisen. Überdies gelang es ihr mit dem Stoß ihres Abtstabes auf den Boden, eine Quelle hervorsprudeln zu lassen. Der Ort dieses Wunders ist der Adelheidis-Brunnen in Pützchen. Der Ortsname ist übrigens eine Ableitung des rheinischen Wortes Pütz für Brunnen.
Die Gebeine Adelheids waren ursprünglich in der Stiftskirche beigesetzt. Sie gingen jedoch bei der Zerstörung der Kirche im Truchsessischen Krieg (1583-1588) verloren. Der Sarkophag im südlichen Seitenschiff von St. Peter ist daher ohne Inhalt; einzelne Reliquien sollen noch vorhanden sein und werden alljährlich am Adelheidisfest jeweils am 5. Februar gezeigt.
Nach dem Besuch der Pfarrkirche St. Peter und dem Gedenken an die heilige Adelheid war noch eine „Stippvisite“ von Burg Lede fest eingeplant, bevor das Bürgermeister-Stroof-Haus besichtigt wurde.
Die Burganlage geht auf eine Wasserburg aus dem frühen 13. Jahrhundert zurück und gilt als typisches Beispiel einer rheinischen Niederungsburg im Bereich eines  alten Rhein- bzw. Siegarmes im sumpfigen Gelände errichtet [Zitat aus dem Info-Flyer der Burg]. Im Rheinland werden derartige Bauten mit „in der La(a)ch“ bezeichnet. Den Namen Lede erhielt die Burg zu Beginn des 20. Jahrhunderts, abgeleitet ist der Begriff aus dem niederdeutschen Lehde und meint damit eine Niederung oder auch Tal. Urkundlich wird die Burg Lede 1361 als Stammsitz des Ritters Johann Schillink von Vilich, Hofmeister und Rat des Kölner Erzbischofs Wilhelm von Gennep (1349-1362) erwähnt. Mehrfach wurde die Burganlage zerstört; 1761 erwarb das Stift Vilich die Ruine. Nach Aufhebung des Stiftes ging die Burg an den Preußischen Staat über. Heute ist Burg Lede in privatem Besitz und wird vom Denkmal- und Geschichtsverein Bonn-Rechtsrheinisch e. V. betreut. alten Rhein- bzw. Siegarmes im sumpfigen Gelände errichtet [Zitat aus dem Info-Flyer der Burg]. Im Rheinland werden derartige Bauten mit „in der La(a)ch“ bezeichnet. Den Namen Lede erhielt die Burg zu Beginn des 20. Jahrhunderts, abgeleitet ist der Begriff aus dem niederdeutschen Lehde und meint damit eine Niederung oder auch Tal. Urkundlich wird die Burg Lede 1361 als Stammsitz des Ritters Johann Schillink von Vilich, Hofmeister und Rat des Kölner Erzbischofs Wilhelm von Gennep (1349-1362) erwähnt. Mehrfach wurde die Burganlage zerstört; 1761 erwarb das Stift Vilich die Ruine. Nach Aufhebung des Stiftes ging die Burg an den Preußischen Staat über. Heute ist Burg Lede in privatem Besitz und wird vom Denkmal- und Geschichtsverein Bonn-Rechtsrheinisch e. V. betreut.
Das Bürgermeister-Stroof-Haus entstand in mehreren Bauabschnitten zwischen dem 15. bis zum 19. Jahrhundert. Den Namen trägt das Haus nach dem ersten Bürgermeister der in der napoleonischen Ära 1808 gegründeten Gemeinde Vilich, Leonard Stroof. Dem Besucher wird ein Interieur aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts gezeigt. Das Stroofhaus beherbergt den Denkmal- und Geschichtsverein Bonn-Rechtsrheinisch e. V., der zugleich Träger der Einrichtung ist. Sie ist überdies eine historische Forschungs- und Bildungsstätte mit Fachb ibliothek, Orts-, Bild- und Denkmalarchiv für den Stadtbezirk Beuel und Beueler Zentralstelle für Familienforschung. Wer ibliothek, Orts-, Bild- und Denkmalarchiv für den Stadtbezirk Beuel und Beueler Zentralstelle für Familienforschung. Wer  Freude an diesen interessanten Themen hat, dem ist ein Besuch dieser Vilicher Einrichtung unbedingt zu empfehlen. Freude an diesen interessanten Themen hat, dem ist ein Besuch dieser Vilicher Einrichtung unbedingt zu empfehlen.
Der Abschluß dieses interessanten Besichtigungsprogramms bildete die „Weinprobe“ mit schmackhafter Beköstigung im mehr als 400 Jahre alten Weinkeller des Stroofhauses. Für Beköstigung mit Wein, Brot und Käse sorgte Kellermeister Müller, dem ganz herzlich zu danken ist.
Ein besonderer Dank gilt Ursula Blondiau. Sie hat mit großem Elan den Chorausflug geplant und alles gut organisiert. Allen hat die Tour nach Vilich gefallen und vor allem für neue Erkenntnisse gesorgt.
|
|
Der Chor feierte am 4. Januar 2019
Eig entlich sollte Weihnachten festlich im Chor begangen werden. Eigentlich – daraus wurde jedoch im zu Ende gehenden Jahr 2018 nichts, denn intensive Proben für die Weihnacht entlich sollte Weihnachten festlich im Chor begangen werden. Eigentlich – daraus wurde jedoch im zu Ende gehenden Jahr 2018 nichts, denn intensive Proben für die Weihnacht sgeschichte des Schlesiers Max Drischner standen dem entgegen. So wurde aus der Weihnachtsfeier ein Neujahrsfest. sgeschichte des Schlesiers Max Drischner standen dem entgegen. So wurde aus der Weihnachtsfeier ein Neujahrsfest.
Wieder einmal gab es unter Ursula Blondiaus ausgezeichneter Regie eine festlich geschmückte, mit vielerlei Leckereien versehene Tafel. Fast alle Sängerinnen und Sänger hatten sich zum Mitmachen eingefunden. Und so gab es neben ein paar Wilhelm-Busch-Versen, einer „Vorlesung“ über die Zeit und Gesang amüsantes Geplaudere an der Festtafel. Wieder einmal hatte Ursula Blondiau ein interessantes Quizz vorbereitet, das von Bernadette Olbrecht souverän gelöst wurde. Dafür wurde sie mit einem kleinen Geschenk belohnt. In gleicher Weise wurde Ursula Blondiau für ihre Verdienste bei der Vorbereitung der Chorausflüge wie auch der Gestaltung sonstiger Choraktivitäten mit einer Gabe bedacht. Chorleiter Friedhelm Loesti wurde – wie alljährlich – mit einem Korb voller Leckereien bedacht. Das muß schon deshalb sein, damit ihm nicht die Kräfte schwinden, fährt er doch allwöchentlich von Oberdollendorf mit dem Fahrrad bergauf-bergab zu den Chorproben nach Birlinghoven. In der Tat: eine bravouröse Leistung!
Der Jahresanfang 2019 gestaltete sich für den Chor ausnehmend positiv; es bleibt zu hoffen, daß das neue Jahr weitere gute Überraschungen – etwa mit neuen Sängern – bereit hält.
|
|
Der Kirchenchor im Jahr 2018 - eine Nachlese
Für unseren recht kleinen Chor kann es als beachtliche Leistung betrachtet werden, wenn er im zu Ende gehenden Jahr an insgesamt zehn Sonnabenden bzw. Sonntagen die Gottesdienste in Stieldorf, Birlinghov en und Heisterbacherrott musikalisch mitgestaltet hat. Die Gottesdienstbesucher bedankten sich zwar immer mit freundlichem Applaus für die chorischen Darbietungen – dafür ist der Chor sehr dankbar - , aber das hat leider, trotz einer Reihe von werbenden Versuchen, nicht dazu geführt, ihn aus der Gemeinde heraus stimmlich zu verstärken. Sehr bedauerlich! en und Heisterbacherrott musikalisch mitgestaltet hat. Die Gottesdienstbesucher bedankten sich zwar immer mit freundlichem Applaus für die chorischen Darbietungen – dafür ist der Chor sehr dankbar - , aber das hat leider, trotz einer Reihe von werbenden Versuchen, nicht dazu geführt, ihn aus der Gemeinde heraus stimmlich zu verstärken. Sehr bedauerlich!
Für den familiären Zusammenhalt des Chores trugen auch in diesem Jahr neben anderen Ereignissen der Besuch des Aloisius-Kollegs mit von der Heydt-Villa - die Villa Rheni -in Bad Godesberg und anschließendem geselligen Beisammensein und die Weihnachtsfeier – auch wenn diese wegen der vorangegangenen Probenbelastungen erst am 4. Januar des neuen Jahres stattfindet - entscheidend bei.
Für ein freundliches Miteinander im Chor sorgt insbesondere Chorleiter Friedhelm Loesti, der nie die Contenance verliert und – auch in der einen oder problematischen Situation – seine gewinnende und ausgleichende Wesensart beibehält.
Sein musikalisches Programm verlangt den Sängern durchaus einiges ab; oftmals wird spürbar, daß die geringe Stimmenbesetzung an die Grenze des musikalisch Machbaren führt.
Umso dankbarer empfindet es der Chronist, und er glaubt, auch für die ganze Chorgemeinschaft sprechen zu dürfen, daß Friedhelm Loesti nach der Christkindlmette des Schlesiers Ignaz Reimann in der diesjährigen Weihnachtszeit sich wiederum einem schlesischen Komponisten, Chorleiter und Kirchenmusiker, und zwar Max Drischner (1891-1971) zugewandt und dessen Weihnachtsgeschichte nach den Worten des Evangelisten Lukas (Kap. 2) zur Aufführung in Birlinghoven (22.12.), Heisterbacherrott (23.12.) und Stieldorf (26.12.) gebracht hat. Zur Bereicherung seiner Orgelbegleitung hatte Friedhelm Loesti zwei Querflötistinnen (Ursula Annerbo für den 22.12. und Lauriane Gerhold für den 23. und 26.12.) gewonnen. Zudem waren die Sopranistin Dr. Anke Bahl und der Tenor Jeffrey Skeer Friedhelm Loestis Einladung gefolgt und verstärkten den Chor stimmlich als Projektsänger. Der Höhepunkt der W eihnachtsgeschichte war zweifellos der Evangelist, den Dr. Julia Kreuzer mit ihrem beeindruckenden, wunderschönen, klangvollen Sopran wirkmächtig zu Gehör brachte. Als zum Abschluß der Applaus der begeisterten Gemeinde erscholl, galt er sicher der Darbietung Julia Kreuzers, aber nicht minder der Leistung des kleinen Chores und ganz besonders der des Chorleiters Dr. Friedhelm Loesti. Seinem Können und unermüdlichen Einsatz ist es zu verdanken, daß Max Drischners Weihnachtsgeschichte in der Weihnachtszeit 2018 dreimal zur Aufführung gelangte. eihnachtsgeschichte war zweifellos der Evangelist, den Dr. Julia Kreuzer mit ihrem beeindruckenden, wunderschönen, klangvollen Sopran wirkmächtig zu Gehör brachte. Als zum Abschluß der Applaus der begeisterten Gemeinde erscholl, galt er sicher der Darbietung Julia Kreuzers, aber nicht minder der Leistung des kleinen Chores und ganz besonders der des Chorleiters Dr. Friedhelm Loesti. Seinem Können und unermüdlichen Einsatz ist es zu verdanken, daß Max Drischners Weihnachtsgeschichte in der Weihnachtszeit 2018 dreimal zur Aufführung gelangte.
Allen musikalisch Beteiligten, besonders aber Friedhelm Loesti, sei sehr herzlich für ihren Einsatz gedankt. Die Aufführung der Weihnachtsgeschichte hat nicht nur der Gemeinde Freude bereitet (wie sich aus einer Reihe anschließender Gespräche ergab), sondern auch den Solisten, den Projektsängern und natürlich dem Kirchenchor.
Obwohl Max Drischner für die Aufführung seiner Weihnachtsgeschichte nachhaltige Regieanweisungen verfaßt hat, wurden sie bei diesen Aufführungen nur bedingt befolgt.
Deshalb aus der Sicht des Chronisten eine Anregung:
Man bringe Drischners Weihnachtsgeschichte als rein musikalisches Opus zu Gehör und verzichte in diesem besonderen Fall auf die übliche Liturgie. Das musikalische Rezitieren der Evangelistenworte allein ist nachdrücklich und versetzt den Zuhörer in ein gläubiges, weihnachtliches Hochgefühl, das zudem noch verstärkt wird von den zwar einfachen, jedoch ausnehmend wohlklingenden vierstimmigen Chorsätzen.
|
|